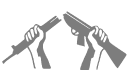Während unsere Politiker nicht müde werden, sich rhetorisch zu den Menschenrechten in aller Welt zu bekennen, schickt man sich an, die strafrechtliche Durchsetzung des Völkerrechts gerade dort zu verkürzen, wo es besonders darauf ankommt: im Krieg.
Nach den schlimmen Erfahrungen in beiden Weltkriegen schien die Militärjustiz im Jahre 1946 endgültig abgeschafft worden zu sein. Der im Rahmen der Wiederaufrüstung der Bundesrepublik im Jahre 1956 ins Grundgesetz eingefügte Artikel 96 GG hatte zwar die theoretische Möglichkeit einer Wehrstrafgerichtsbarkeit eröffnet. Wegen des zu erwartenden öffentlichen Widerstandes scheute man aber schon die bloße Diskussion darüber. Dennoch machten sich bald nach Gründung der Bundeswehr Juristen im Bundesjustiz- und Bundesverteidigungsministerium in aller Heimlichkeit an die Planung einer eigenständigen Militärjustiz.
In den Schubladen wurden bis zum Jahre 1975 fertig erarbeitete Gesetzentwürfe bereitgelegt, die für Desertion und andere Disziplinverstöße einen drastisch verkürzten Rechtsschutz vorsahen, auch die Aufstellung von Sondereinheiten, vergleichbar den Bewährungskompanien der Wehrmacht. In Manövern auf Sardinien und Kreta simmulierte man Gerichtsverhandlungen mit Staatsanwälten, Richtern und angeklagten Soldaten. Das konspirative Vorhaben mußte abgebrochen werden, als ein unbekannt gebliebener Whistleblower im Jahre 1981 die Schubladengesetze meinem Freund Ulrich Vultejus zuspielte, dessen Buch "Kampfanzug unter der Robe" den Spuk endgültig beendigte.
Dass die Forderung nach einer Sondergerichtsbarkeit fürs Militär heute wieder aufkommt, ist kein Zufall in einer Zeit, da in den Auslandeinsätzen zunehmend Zivilisten Bombenangriffen und anderen militärischen Exessen zum Opfer fallen. Diese Gefahr hat im Zuge einer Waffenentwicklung zugenommen, die darauf gerichtet ist, die Zahl der eigenen Opfer zu minimieren und zugleich die des Gegners zu maximieren. Zugleich zeigt sich das Bestreben der militärischen Akteure, sich den durch das Recht gesetzten Einschränkungen zu entziehen. Man möchte der Gefahr einen Riegel vorschieben, dass was die Politik lieber unter den Teppich gekehrt sehen möchte, aufgeklärt und gar von unbefangenen Juristen geprüft wird. Unverhohlen rief der frühere Verteidigungsminister Franz-Josef Jung mit der Forderung "Soldaten dürfen nicht mit staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen konfrontiert werden" nach einer Justiz mit bloßer Feigenblattfunktion, denn, so Jung weiter, ein Strafverfahren gegen Oberst Georg Klein mit dem Ziel der Aufklärung des Massakers bei Kunduz hätte "katastrophale Folgen" für die Bundeswehr. Nach Erschießungen einiger afghanischer Zivilisten dachte man schon einmal an eine "Militärjustiz mit Staatsanwälten, die mit in den Dienst entsandt werden".
Angesichts der Vergangenheit der deutschen Militärjustiz sind solche frommen Wünsche nach einer regulären Sondergerichtsbarkeit mit fest in die militärischen Strukturen eingebundenem Personal vorerst politisch nicht durchsetzbar. In der Aushebelung des Verfassungsrechts geübte Ministerialjuristen haben inzwischen aber einen Weg gefunden. Das Ziel ist eine mit "zuverlässigen" Juristen besetzte Justizstruktur, die sicherstellt, dass die Auslandsaktivitäten der Bundeswehr vom Recht möglichst ungestört bleiben. Deshalb sah schon der 2009 zwischen CDU/CSU und FDP geschlossene Koalitionsvertrag die Einrichtung einer "zentralen Zuständigkeit der Justiz" für Bundeswehr-Auslandssachen vor. Dafür soll eine "Schwerpunktstaatsanwaltschaft" mit Sitz in Leipzig eingerichtet werden. Unter Hinweis auf den "Spezialisierungseffekt" wird auf das Erfordernis "besonderer Kenntnisse, etwa zu den rechtlichen und konkreten Rahmenbedingungen" der Auslandseinsätze verwiesen, insbesondere Kenntnisse der "konkreten militärischen Abläufe". Solche bundesweiten zentralen Zuständigkeiten hat man bislang aber nicht einmal für solche Strafsachen, etwa für Wirtschafts- und Korruptionsdelikte oder die Bearbeitung von NS-Gewaltverbrechen erwogen, bei denen eine einheitliche Bearbeitung eine zügige Erledigung erleichtern würde.
Die Gefahren einer Zusammenziehung aller Auslandsmilitärstrafsachen bei einer einzigen Behörde dürfen nicht übersehen werden. Die Vorstellung, die Staatsanwaltschaft sei die "objektivste Behörde der Welt" (Franz von Liszt) ist ein frommer Wunsch. Mit der Verdichtung des Verbindungsstranges zu den vorgesetzten Behörden erhält das den Machtpolitikern unverzichtbare Weisungsrecht der Exekutive, von dem die meisten Staatsanwälte im konkreten Fall nur hinter der vorgehaltenen Hand sprechen, eine noch größere Bedeutung. Nur selten bekennen sich allerdings Vorgesetzte zu ihrer Einmischung und räumen ein, dass es ihnen dabei nicht um korrekte Rechtsanwendung geht, sondern um "das Kräfteverhältnis der politischen Strategien, Erwünschtheiten und Verträglichkeiten" (so der Münchener Generalstaatsanwalt Hermann Froschauer).
In diesem Sine läßt der in der Begründung des im Jahre 2010 erarbeiteten Referentenentwurfs des Bundesjustizministeriums enthaltene Hinweis auf die angeblich von der Spezialisierung erhoffte "Verbesserung der Entscheidungsqualität" aufhorchen. Wenn Juristen sich nur noch mit einem einzigen Rechtsbereich befassen, in diesem Fall sogar in enger Tuchfühlung mit der Bundeswehrführung, kann es eher zu einer Blickverengung durch Betriebsblindheit führen. Schon die Konzentration der Staatsschutzverfahren insbesondere gegen Kommunisten zu Zeiten des Kalten Krieges auf wenige Gerichte hat dazu geführt, dass die Justiz jahrelang voll den an sie gestellten Erwartungen entsprach. Auch damals wurde die Verfahrenskonzentration im Rechtsausschuß des Bundestages mit dem Erfordernis begründet, "besonders hochwertige Richter für die Aufgabe zu finden, die nicht jedem liege".
Wie schon bei den Argumenten der Militärs, begründet auch der Gesetzentwurf des BMJ die Neuregelung vor allem mit der erhofften "Rechtssicherheit für die Soldaten". Nach einem Wort über die Notwendigkeit eines rechtlichen Schutzes der Opfer sucht man vergeblich. Zusammen mit dem im Bereich militärischer Delikte bewusst schwammig gehaltenen Völkerstrafgesetzbuch von 2000 würde die Einrichtung einer Sonderzuständigkeit in Leipzig auf einen Freibrief für "Kollateralschäden" jedweder Art hinauslaufen. Mit dem Hinweis auf die "militärischen Notwendigkeiten" soll der Opferschutz im Grundsatz ebenso ausgehebelt werden, wie der Oberstkriegsgerichtsrat Werner Hülle (nach 1945 Bundesrichter und dann Oberlandesgerichtspräsident in Oldenburg) zur Durchsetzung der "Mannszucht" auf Gerichtsentscheidungen bestand, von denen nicht nur "gerechte, sondern auch zweckmäßige, d.h. militärisch verwertbare Erkenntnisse erwartet" werden. Wie sich die Bilder gleichen!
Helmut Kramer